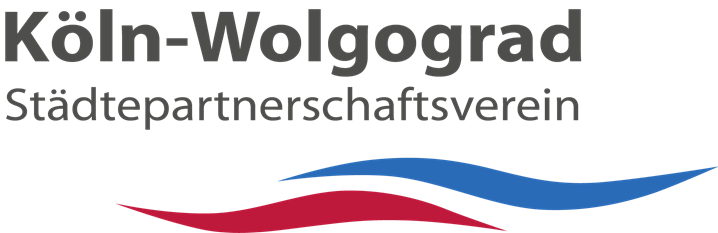
Kölner Hilfsprojekt in Wolgograd in Gefahr
Im Zweiten Weltkrieg haben die Deutschen in vielen Ländern nicht nur Tod und Zerstörung angerichtet, sondern auch viele Zivilisten verschleppt, teils nach Deutschland, teils innerhalb der besetzten Gebiete, und sie zu Arbeiten für ihre Zwecke gezwungen. Nach dem Krieg galten diese Menschen in der Sowjetunion als Kollaborateure der Deutschen und wurden erneut missachtet und benachteiligt, wenn sie nicht ihre Biografie verheimlichen konnten.
1989, gleich zu Beginn der Städtepartnerschaft zwischen Köln und Wolgograd, kamen nach einer Suchanzeige in der Wolgograder Presse viele Kontakte zwischen KölnerInnen und ehemaligen ZwangsarbeiterInnen zustande, aus denen sich so manche Freundschaft entwickelte. Im Rahmen dieser persönlichen Beziehungen wurde auch materielle Hilfe geleistet.
Im Jahr 2002 stellte die Stadt Köln einen größeren Geldbetrag für ein Hilfsprogramm in Wolgograd zur Verfügung, mit dessen Durchführung die Stadt den Partnerschaftsverein betraute. Seitdem organisierte der Kölner Verein mithilfe des dafür in Wolgograd extra eingerichteten „Zentrums zur Unterstützung nichtkommerzieller Organisationen“ einen ambulanten Pflegedienst für die alten Menschen, die meist mit sehr niedrigen Renten unter Krankheiten, Depressionen, Einsamkeit litten und sich oft kaum noch selbst helfen konnten.
Neben medizinischen und hygienischen Materiallieferungen werden vor allem fünf Sozialarbeiterinnen in Wolgograd bezahlt – mit recht geringen Löhnen -, die regelmäßig Hilfe leisten. Zu Beginn des Hilfsprojektes gab es in Wolgograd noch etwa 1.000 Personen, die in deutscher Gefangenschaft arbeiten mussten, oder die dort als Kinder von Zwangsarbeitern mit betroffen waren. Zurzeit sind es noch ca. 80 Personen, die als Kinder unter Zwangsarbeiter-verhältnissen aufwuchsen; ca. 60 von ihnen bedürfen intensiver Hilfe. Es sind Menschen, die zum Teil aus Wolgograd stammen, zum Teil stammen sie aus anderen Gegenden, auch aus der Ukraine, und sind später nach Wolgograd gekommen; die Ukraine hat ja unter den Deutschen mindestens ebenso gelitten wie Russland.
Die Finanzierung des Projektes hatte im Lauf der Jahre verschiedene Quellen. Die Stadt Köln war einige Jahre zu Beginn und die letzten 4 Jahre beteiligt (bis Ende 2025). Die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“ konnten wir über 10 Jahre als Hauptstifter gewinnen. Der Verein selbst hat sich über Mitgliederbeiträge und Spenden immer an den Kosten beteiligt. Die Geldlieferungen werden sowohl in Köln als auch in Wolgograd sehr genau kontrolliert, sodass die Zweckgebundenheit von beiden Seiten aus gesichert ist. Seit dem Krieg in der Ukraine sind die Geldlieferungen infolge der SWIFT-Kündigung und aufgrund verstärkter russischer Kontrollen schwierig geworden, aber der Städtepartnerschaftsverein hat über verschiedene Kontakte legale Wege gefunden, um den Geldtransfer zu sichern.
Wir wollen das Projekt trotz der aktuellen politischen Schwierigkeiten fortführen, um die Opfer des deutschen Krieges so lange zu unterstützen, wie es nötig ist. Das wird noch ein paar Jahre lang eine der Hauptaufgaben des Vereins sein, neben der Pflege anderer menschlicher und kultureller Beziehungen. Der Rat der Stadt Köln hat 2025 beschlossen, dass die finanzielle Hilfe der Stadt letztmalig mit 15.000 € für das Jahr 2025 gewährt wird.
Wir müssen also neue Geldgeber finden und/oder den zukünftigen Rat der Stadt um einen korrigierenden Beschluss bitten. Zur Illustration, um welche Menschen es geht, zitieren wir aus Berichten, die im Juli 2025 von Jelena Shatokhina (Geschäftsführerin des Hilfsprojekts in Wolgograd) in Gesprächen mit noch lebenden Betroffenen erstellt worden sind.
(Übersetzungen Eva Aras, Köln)
Biografie Valentina Andrejevna Baraschina
 Ich bin 1942 in Stalingrad geboren. Zusammen mit der Mutter, die 21 Jahre war, vertrieb man mich nach Deutschland, auf einem offenen Waggon, ich war 2 Monate alt. In Deutschland arbeitete die Mutter bei der Eisenbahn. Was mit mir war, wo ich war, weiß ich nicht. Die Mutter hat nie über die Zeit geredet. Als ich 3 Jahre alt war, kehrten wir nach Hause zurück. Als wir nach Hause fuhren, hat man oft geschaut, ob ich noch atme. 6 Jahre konnte ich nicht gehen, redete nicht.
Ich bin 1942 in Stalingrad geboren. Zusammen mit der Mutter, die 21 Jahre war, vertrieb man mich nach Deutschland, auf einem offenen Waggon, ich war 2 Monate alt. In Deutschland arbeitete die Mutter bei der Eisenbahn. Was mit mir war, wo ich war, weiß ich nicht. Die Mutter hat nie über die Zeit geredet. Als ich 3 Jahre alt war, kehrten wir nach Hause zurück. Als wir nach Hause fuhren, hat man oft geschaut, ob ich noch atme. 6 Jahre konnte ich nicht gehen, redete nicht.
Nach der Rückkehr erinnere ich mich nur an Trümmer, Zerstörung.
Biografie Ljudmila Aleksandrovna Revunova (Zacharova)

Ich bin am 11.12.1935 in der Stadt Antrazit im Lugansker Gebiet geboren.
Zu Kriegsbeginn lebte die Familie im Donbass (Ukraine). Zu Kriegsbeginn zog man den Vater ein und schickte ihn in die Sommerschule nach Kujbyschew (heute Samara), nach deren Abschluss war er an der Front als Pilot-Stürmer. Die Mutter, ich und meine Schwester Alla wurden in die Nähe von Stalingrad evakuiert, wo die Eltern der Mutter lebten.
Ich erinnere mich (während der Verschleppung) an die Wege, die Bombardierungen. An irgendeinem Ort versteckten wir uns in der Nähe eines Feldes. Nach einem Fliegerangriff sahen wir anstelle des Nachbarhauses einen riesigen Trichter. Die ganze Familie kam in dem Haus um, nur ein kleines Kind wurde durch die Druckwelle aus dem Haus herausgeworfen. Irgendjemand nahm sich seiner an.
Lange fuhren wir mit Fuhrwerken. In irgendeinem Dorf hielten wir an. Die Mutter hatte große Angst, dass die Deutschen erfuhren, dass unser Vater Offizier in der Armee ist, sie versteckte uns die ganze Zeit. Aber wir gerieten in Gefangenschaft. …
Dann brachte man uns in ein Sammellager in Leipzig und schließlich in einen Bauernhof in der Nähe von Dresden. Wir lebten in einer Holzbaracke, die Mutter arbeitete den ganzen Tag auf dem Feld, melkte Kühe und mistete den Stall aus. Sie bereitete das Viehfutter zu, erntete Kartoffeln und rote Beete, kümmerte sich um das Vieh. Dann erkrankte sie an Rheumatismus, der sie bis ans Lebensende quälte. Meine Schwester und ich waren noch sehr klein, wir arbeiteten nicht.
1945 wurden wir befreit, kehrten in die Heimat zurück. Unsere Mutter suchte den Vater, er arbeitete in Deutschland in der Kriegskommandantur in Plauen, aber er hatte schon eine andere Familie.
Wir kehrten mit der Mutter nach Stalingrad zurück. Ich ging zur Schule, dann habe ich das Schiffsbautechnikum abgeschlossen. Das ganze Leben, mehr als 30 Jahre, habe ich in einer Schiffswerft als Mechanikerin gearbeitet. Ich habe alles verheimlicht, niemand wusste, dass ich in Deutschland war. Diejenigen, die in Deutschland in Gefangenschaft waren, lehnte die sowjetische Gesellschaft ab, man verdächtigte sie der Kollaboration, der Zusammenarbeit mit dem Feind. Ich habe nie in einem Antrag/Fragebogen geschrieben, dass ich in Deutschland war. Meine Mutter sagte immer: „Sieh zu, dass du nicht schreibst, dass wir in Gefangenschaft im Lager waren“.
Biografie Nikolaj Vasiljevitsch Lopuchov

Ich bin im November 1941 geboren in eine Familie mit vielen Kindern im Dorf Novaja Pogosch des Suzemskij-Bezirks in dem Gebiet Brjansk. Der Vater ging in den Krieg. Wir – mein älterer Bruder, 2 Schwestern und unsere Mutter – blieben zu Hause. Die Deutschen kamen ins Dorf, die meisten Häuser wurden verbrannt. Die ganze Familie und auch andere Dorfbewohner wurden auf die ukrainische Seite geschickt. Die Leute wurden abtransportiert – ein Teil nach Deutschland, ein anderer Teil nach Lettland. Wir gerieten nach Lettland, wo wir ins Lager Salaspils (Kurtenhof) kamen. Nach den Erzählungen der Verwandten nahm man uns alle Sachen weg, wusch uns in Eiswasser, danach verteilte man uns in Baracken, Kinder und Erwachsene getrennt. Kinder wurden auch von ihren Eltern getrennt. Viele Frauen sind einfach verrückt geworden, wurden geschlagen, teilweise erschossen.
Es gab keine Vornamen und Familiennamen, nur Nummern, die in die Haut eingezeichnet wurden. (Nikolai Vasiljevitsch versuchte, seine Nummer nach dem Krieg zu entfernen, auf dem Arm blieb eine dunkle senkrechte Linie zurück). Die Schwester brachte man in einer anderen Baracke unter, wo man ihnen Blut abnahm – das erzählte man mir. Sie sind aus dem Lager nicht zurückgekehrt, sie kamen um. Mein Bruder war damals 7 Jahre alt, und er suchte Abfälle aus der Küche, briet das auf dem Feuer und fütterte mich. Nach dem Krieg wollte er nicht über die Zeit reden. Bis heute kann ich mir nicht vorstellen, wie es ihm gelang, mich 3 Jahre zu ernähren und sich um mich zu sorgen. Die Mutter musste zur Arbeit zu einem Bauern gehen, ein Wiedersehen mit den Kindern gab es 1-2 Mal in der Woche.
1945 wurden wir von der Roten Armee befreit. Nach der Prozedur der Filtrierung (Überprüfung) wurden wir im Herbst ins Heimatdorf geschickt. Häuser gab es keine und die Leute begannen langsam, Hütten zu bauen. Es war eine hungrige Zeit. Mutter sammelte Gräser, Kräuter und bereitete daraus Essen. Die Kinder suchten im Wald Beeren und Früchte. Der Bruder wurde vom Hunger völlig dürr, konnte sogar nicht gehen – es ist unklar, ob vom Hunger oder von dem, was er im Lager ertragen musste. Ich erinnere mich, dass ich im Wald Beeren sammelte und ihm brachte.
Die Mutter sagte immer uns Kindern, dass wir niemandem erzählen dürfen, dass wir verschleppt wurden. Meine Mutter und mein Bruder redeten nie über die Jahre im Lager. Die schrecklichen Jahre verschwammen ungewollt mit dem schweren, entbehrungsreichen Nachkriegsleben.
Wir waren wie Menschen 2. Klasse. Es gab Begrenzungen in unseren Bürgerrechten. In den persönlichen Dokumenten war die Bemerkung „er befand sich im Krieg in den besetzten Gebieten“, die oft das weitere Leben verdarb. Mit dieser Bemerkung im Ausweis war eine Hochschulausbildung kaum möglich, man konnte auf der Arbeit bestimmte Positionen nicht einnehmen oder in einigen Unternehmen nicht arbeiten….
Aber langsam ordnete sich alles. Im Dorf gab es nun eine Grundschule. Nachdem ich 7 Klassen beendet hatte, machte ich eine Ausbildung als Traktorist in der Fachschule für Landwirtschaft. Nach dem Wehrdienst fuhr ich auf Dienstreise des Komsomol ins Wolgograder Gebiet. Hier arbeitete ich in der chemischen Industrie als Facharbeiter. Dort traf ich meine Frau, mit der ich seit 60 Jahren zusammen bin.
Spendenkonto:
Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Köln-Wolgograd
IBAN DE66 3705 0198 1931 9330 95
Verwendungszweck: „Hilfsprojekt“
Eva Aras, 09.10.2025

